
Bernd Weikl aus gegebener Veranlassung

1996 erhielt ich eine Einladung von der CSU in München, im Kontaktkreis Politik-Wissenschaft-Kultur über das Thema „Staatliche Kunstförderung – Markt der Beliebigkeit?“ einen Vortrag zu halten. Hier meine Aussagen in dieser 9. Künstlerbegegnung, denen insbesondere meine Erfahrungen, aber auch Studien im Kontext eigener Bücher und wissenschaftlicher Projekte zugrunde liegen.
- Künstlerbegegnung am 1. Juli 1996 in München
Hier mein Text entsprechend des Tonbandmitschnitts von Eva Zilch, CSU, 4. Juli 1996 und der völlig falsche und mich diffamierende Bericht von Herrn Gerhard Matzig im berüchtigten Kasten in der Süddeutschen Zeitung vom 3. Juli 1996
Meine Aussage: In Deutschland ist der Nutzen von Kunst und Kultur unstrittig – und explizit wird jener z. B. in der bayerischen Verfassung als Ländersache definiert: Bildung soll nicht nur Wissen und Können, sondern auch Herz und Charakter erreichen und die Ehrfurcht vor der Würde des Menschen (…) im Geiste der Demokratie (…) und im Sinne der Völkerversöhnung (vermittelt) Herzens- und Charakterbildung, Persönlichkeitsbildung sind mithin eine Bringschuld der staatlichen Gemeinschaft an sich selbst.
Auszug aus Artikel 131 Bayerische Verfassung
Beim Konsumenten soll durch das Produkt Kunst Imagination, Phantasie und Kreativität angeregt werden. In der Folge kommt es beim Glücksfall zu einer Sensibilisierung, zur Kultivierung des Einzelnen, was sich hoffentlich multipliziert hin zu einer funktionierenden, zivilisierten, mitmenschlichen und toleranten Gemeinschaft. Natürliches Sozialverhalten ist dann selbst-verständliche Maxime. Und erfreuen soll es uns auch, das Kunstwerk, meine ich.
Weikl, Bernd (2017): Singen in der Oper, als Therapie und in der Post- und Postpostmoderne
Benötigen wir staatliche Kunstförderung für Theater und Oper, wenn es doch soviel kostengünstige Unterhaltung gibt? Erlauben Sie mir bitte einen kurzen Ausflug in die Medizin: Das Hören von Rock-, Pop- und Marschmusik zum Beispiel führt aufgrund des ostinaten, gleichmäßigen Rhythmus’ und der gleichförmigen Dynamik und Tonart zu einer rein motorischen Einstellung zur Musik. Das bedeutet, geistige Einflüsse werden dabei weit-gehend zurückgedrängt.
Vgl. hierzu: Spintge, Ralph/Droh, Roland (1992): Musik – Medizin, Gustav Fischer, Stuttgart.
Am 3. Juli 1996 widmet mir die sehr renommierte Süddeutsche Zeitung ihren vernichtenden Kasten unter dem Titel: „Eine sehr, sehr deutsche Rede“. So nannte der bayerische Generalintendant im Publikum am 1. Juli 1996 meine Aussagen. Am 4. Juli 1996 sandte ich dem zuständigen Journalisten von der SZ meine Gegendarstellung zu seinen mir in den Mund gelegten Aussagen, die natürlich nicht beantwortet wurde. Aus gegebener Veranlassung wiederhole ich den Vorgang heute mit weiteren Erklärungen.
Im Artikel „Eine sehr, sehr deutsche Rede“ ist der Titel des Kastens in der SZ vom 3. Juli 1996. Dort wurde über meinen Diskussionsbeitrag in der 9. „Künstlerbegegnung“ behauptet:
- Eigentlich hätte sich Weikl zum an sich leisen und trockenen Thema „Staatliche Kunstförderung“ äußern sollen. Aber statt-dessen erklang seine Stimme im Max-Josef-Saal der Münchner Residenz schwer und voll.
Ja, schwer und voll: Das stimmt. Ich habe auch noch 20 Jahre später eine durchtrainierte volltönende Sängerstimme. Damit habe ich den bayeri-schen Bildungsauftrag zitiert und erklärt und anhand psychologischer Gesetze und eigener Studien an der Psychiatrie der Ludwig-Maximilians-Universität, Nussbaumstraße München und Krankenhaus für Psychiatrie Baumgartner Höhe in Wien nachgewiesen. Siehe hierzu oben (Singen etc.) meine wissenschaftlichen Veröffentlichungen im Leipziger Universitätsverlag .
- Es gäbe so wenig deutsche Star-Dirigenten, weil die urdeutsche Kultur „systematisch“ ausgehöhlt würde.
Das ist völlig frei erfunden! Ich habe das weder wörtlich noch sinngemäß vorgetragen.
- Das Fernsehen wäre in direkter Linie verantwortlich für die zunehmende „Kriminalität hierzulande“.
Auch das ist falsch und frei erfunden! Ich habe das Fernsehen nicht als in direkter Linie verantwortlich für die Kriminalität in Deutschland bezeichnet. Dazu der Schauspieler Till Schweiger im Nachtmagazin vom 21. Juli 2015: „Das Fernsehen trägt dazu bei, dass Leute so abgestumpft sind.“
Die heutigen Video- und Printmedien berichten täglich und keineswegs nur nachts vor kleinem Publikum, sondern bei höchsten Einschaltquoten über brutale Handlungen. Ob das 21. Jahrhundert dabei noch Rücksicht auf „unsere Jugend“ nimmt, verneint die Psychologin, Therapeutin und Autorin Gabriele Baring. Und weiter sagt sie: „Wenn Kinder täglich Gewalt, Morde und Vergewaltigungen im TV und Internet sehen und sich das auch noch in Computerspielen stundenlang ,reinziehen‘, dann prägt sie das. … sie sehen dann Gewalt als Lösung ihrer Probleme.“
Vgl. dazu BILD vom 11.01.2014.
Wissenschaftliche Studien bestätigen schon lange Gabriele Barings Einsichten, die Feststellung Till Schweigers. Sie legen eine deutliche Verbin-dung zwischen Sehen und Handeln nahe. Eine regelmäßige Beobachtung von Gewalt kann zu einer psychischen Abstumpfung, einer Betäubung gegenüber dieser Gewalt führen.
Vgl. dazu Gerrig, Richard J./Zimbardo, Philip G. (2008): Psychologie, 18. aktualisierte Ausgabe, Pearson Studium, München
- Wir sind ausgelaugt von aus dem Ausland „importiertem Schuldgehabe“.
Völlig falsch! Ein Schuldgehabe war und ist nicht importiert! Unsere Künstler werden im Ausland nicht mit jenen offenen Armen aufgenommen wie die ausländischen Künstler vergleichsweise bei uns. Deutschland ist hier nachweislich inländerfeindlich.
Arbeitsrechtliche Gesetze für ausländische Arbeitnehmer, werden z. B. in den USA strikt befolgt und in Deutschland auch gerne umgangen. Inländer haben es also sowohl im Inland als auch im Ausland besonders schwer.
- Bernd Weikl hat sich gegen moderne Opern und die in ihnen enthaltenen Provokationen gewandt.
Das war glatt gelogen. Es wurde eine Oper für mich komponiert: „Oswald von Wolkenstein“. Komponist: Wilfried Hiller, Text: Felix Mitterer, Regie: Percy Adlon.
Richtig wäre weiterhin gewesen, zu schreiben, dass ich mich unter Beifall bei meinem Vortrag für die Schaffung, Förderung und Aufführung moderner Opern geäußert habe.
- Die Oper muss von unseren „eigenen Leuten“ gemacht werden, schob mir dieser Musikjournalist einfach als Aussage unter.
Auch das war falsch. So manches Ausland hält sich eben an die Gesetze zur Einführung von immateriellen Dienstleistungen. Wir tun nachweislich das Gegenteil. Und ebenso richtig ist, dass ein bayerischer Kultusminister, ein bayerischer Generalintendant und ein Musikkritiker eigentlich über diese arbeitsrechtlichen Einfuhrbestimmungen, die hier wohl genauer Einfuhr-beschränkungen genannt werden müssten, für Deutsche im Ausland genau-estens hätten informiert sein müssten. Dazu passt heute das „America first“, des amerikanischen Präsidenten.
- Gewisse Künstler sollten besser „eingesperrt“ als gefördert werden.
Falsch! Richtig war, dass ich geäußert habe: Regisseure, die eine gewisse Meistersinger-Inszenierung verbrochen haben und dann noch dem Publikum den Hintern zuwenden, sollten besser eingesperrt werden.
- Dem Kammersänger gelang sogar noch dieser Satz: „Ich verbitte mir den Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit!“
Falsch! Wir sind inländerfeindlich. Das habe ich gesagt und oben begründet.
„… schön und erhaben … süß wie Zuckerbrot“, jubelt mir der Journalist Gerhard Matzig im Kasten der Süddeutschen Zeitung vom 3. Juli 1996 auch noch unter. Eine sehr gebräuchliche Redensart: Das Opernpublikum will Zuckerbrot statt Peitsche. Die Münchner Abendzeitung nimmt das sogar in den Titel der Ausgabe vom 3. Juli 1996
Und Wieder Herr Matzig: „Ständig diese sozialen Provokationen! Darf, liebe Landsleute, darf die Oper provozieren? Und schön und erhaben soll die Oper sein.“
Damit erklärt der Journalist, dass er eben für Provokationen in den Regie-konzepten eintritt. Das Publikum soll schockiert werden, dieser über-flüssige Feind im Auditorium. Da sind aber sehr namhafte Musikkritiker in der SZ ganz anderer, nämlich meiner Meinung über den Sinn „der schönen Künste“. Ich zitiere einige davon in diesem Bericht.
Aber zuerst der damalige Bayerische Generalintendant im Auditorium. Protokolliert ist Herrn August Everdings Einwurf an diesem 1. Juli 1996: „… noch gerade Sachs gesungen, haben Sie eine so schöne deutsche Rede gehalten. Hauptwort von Sachs ist Wahn, Wahn, Wahn … Sollen wir spielen, was gefällt, gefällt? Oper hat nur Zuckerbrot zu liefern? Nein, wenn Oper nur Zuckerbrot zu liefern hat, dann weiß ich nicht, wann wir ,Elektra‘ aufführen sollen. Schwarzbrot will ich, nicht Zuckerbrot. Beliebt ist, was gefällt – danach handeln wir doch nicht. Ja, aber beliebt ist was ankommt! Und wir brauchen nicht anzukommen, sondern bei uns kommt es darauf an, was, worauf es ankommt, nicht was ankommt, sonst mache ich doch gleich ein Musical!“ Der Münchner General-intendant redete hier absoluten Unsinn und hat wohl schon damals den Zeitgeist mit seinen Hakenkreuzen, Exkrementen, Blut, Schwulen, Transen usw. auf den Bühnen nicht mitbekommen; oder er wollte sich aus takti-schen Gründen nicht dagegen aussprechen.
Der mit mir Zeit seines Lebens befreundete Leonard Bernstein war mit mir einig in seiner Aussage: „Was haben wir Künstler mit Öl und Wirtschaft, mit Überleben und Ehre zu tun? Die Antwort ist: Alles. Unsere Wahrheit, wenn sie von Herzen kommt, und die Schönheit, die wir aus ihr hervorbringen, sind vielleicht die einzigen wirklichen Wegweiser, die einzigen klar sichtbaren Leuchttürme, die einzige Quelle der Erneuerung der Vitalität der menschlichen Weltkulturen.“ Er hatte das Glück, 1996 nicht mehr am Leben zu sein, sonst hätten ihn am 1. und 3. Juli jenes Jahres die Herren Everding und Matzig – so wie mich – in Grund und Boden vernichtet.
Und von „schön und erhaben“ schreibt Joachim Kaiser nur einen Monat nach meinem Vortrag am 8. August 1996 in der SZ. Erstaunlicherweise (oder vielleicht auch nicht) wurde ich damit schon wieder und aus-gerechnet in der SZ mit den mir untergeschobenen Aussagen zum heutigen Regisseurstheater von Herrn Kaiser vollständig bestätigt. Wir lesen: „Muss man die Kunst vom Sockel holen? Einige Gedanken über Protest und Bewunderung: Ist es angemessen, großer, traditioneller Kunst die Aura des Besonderen wegzunehmen? … Steckt nicht auch Zerstörungslust in diesem Applanieren? … Aufklärer, die für ihre Kulturprodukte Reklame machen, unterschlagen alle Mühe und Arbeit, die geleistet, alle Durststrecken, die in Kauf genommen werden müssen, wenn jemand dem Schönen und Erhabenen so gewachsen sein möchte, dass diese Ansprache sich in Genuss, in Beglückungen und prägende Erfahrungen verwandeln können“. Joachim Kaiser spricht hier vom „Schönen und Erhabenen“, und der Journalist des mich sehr erfolgreich vernichtenden Kastens schiebt mir genau diese Worte als unmögliche Aussage unter.
Christopher Schmidt kritisiert in der SZ am 14. November 2006 das „Elend der deutschen Subventionskultur“ und wird damit zum Für-sprecher der „Schönen Künste“. Gegen das „Schöne und Erhabene“ müsse man antreten und „Schwarzbrot, anstatt Zucker-brot“ konsumieren, meinte Herr Everding. Das Schwarzbrot beinhaltet heute den Stuhlgang, Blutsturz und andere Körperflüssigkeiten. So berichtet Schmidt über die Ingredienzien, die ein Muss für zeitkonforme Regiekonzepte sind. An allen Bühnen, meint er, wird Blut zu einer überaus dominierenden Requisite. Dazu werden naturalistisch gefüllte Kotbeutel gereicht. Liebe zeigt sich als Sling-Sex und Vergewaltigung, als Fist- und Foot-Fucking. „Könnte es sein“, fragt Schmidt mit deutlichem Sarkasmus, „dass unser Theater heute das Blut so sehr liebt, weil es selbst blutleer ist?“ Und er wird noch deutlicher: „Nach dem zweifellosen Verlust seiner Relevanz muss das Theater sich heute fragen lassen, welche Zwecke noch seine Mittel heiligen.“ Um dieser Frage auszuweichen, kehre es einfach die Beweislast um und unter-stelle seinem Publikum, es sei unaufgeklärt, auch verdrängungsselig, eska-pistisch, aufbaubedürftig, konsumgierig, kuschelbedürftig und vollgestopft mit Ressentiments. Diese Vorwürfe könne es nur entkräften, indem es sich erpressen ließe und sich der Tugend enthielte, die das Theater eigentlich vorgäbe, ihm zu vermitteln, nämlich das selbständige Denken. „Ist das Theater ein Verbrechen“, meint Schmidt weiter, „weil es Auschwitz nicht verhindert hat? Und wieso hat der Mann mit dem gestutzten Oberlippenbart immer noch so viel Macht über uns?“ Das deutsche Theater sei offenbar auf den Hund gekommen.
- Der bayerische Generalintendant nannte das „Eine sehr, sehr deutsche Rede“ Dies wurde zum Titel des Kastens am 3. Juli 1996. Und dort nannte der Journalist meine Aussagen sogar „dumpfdeutsch und deutsch-national“.
Ich habe damals und bis heute genügend darüber verfasst. Alles dies soll auch meinen jüngeren Kollegen demonstrieren, was sie in diesem Beruf an Hilfe in Deutschland zu erwarten haben.
- Der Journalist der SZ wandte sich auch gegen das klatschende Publikum, das – so meinte er – sich aus CSU- nahen Zeitgenossen zusammensetzte.
Nach meinem Vortrag vom 1. Juli 1996 und dem Kasten in der SZ „Eine sehr, sehr deutsche Rede“ vom 3. Juli 1996 schrieb der bayerische Umweltminister am 5. November 1996 zu diesem Sachverhalt: „Im Ergebnis sind sich, was viele Einzelwortmeldungen seit der Kontaktkreisdebatte (vom 01.07.1996) belegen, die Künstler in diesem Kreis aber einig: Während Engagements für Ausländer (z. B. auf deutschen Bühnen) die von dort gern genutzte Regel geworden sind, hier die Einsatzmöglichkeiten der eigenen Klientel kräftig beschränken, ordentlich schwer. Oder kurz gefasst: Wir pflegen die Internationalität, andere ihren nationalen Stolz. Einer solchen Behauptung mit beleg-baren Tatsachen entgegen zu treten scheint fast ausgeschlossen. Das bestätigen die Fakten, von denen nicht nur die Bühnenstars der Oper, sondern daneben auch die Bildenden Künstler, die Architekten, die Karikaturisten (unter vier Augen), die Maler und andere berichten.“
„Wir Deutsche“, entgegnete der für Kultur zuständige bayerische Minister am 26. November 1996, „sollten als allerletzte auf die Idee kommen, hier die Schotten dicht zu machen. Unsere jüngste Vergangenheit ist dafür nicht das alleinige Argument.“ Und im gleichen Schreiben heißt es: „Künstlerische Entscheidungen sollten meiner Meinung nach überhaupt nicht nach Nationalkriterien, sondern einzig und allein nach der künstlerischen Leistungsfähigkeit getroffen werden. Kurz gesagt: In der Kulturpolitik gibt es so manches Thema, über das sich trefflich diskutieren ließe; das von Herrn Weikl mit Vorliebe beackerte Themen-feld gehört wahrlich nicht dazu. Auch liegt es auf der Hand, dass deutsche Künstler das deutsche Repertoire singen.“
Wenn also ein bayerischer Kultusminister fern aller Realität glaubt, es sollte bei den Engagements nicht um Nationalitäten, sondern um künstlerische Leistungsfähigkeit gehen, dann hat er keine Ahnung vom Wettbewerb, der bei einer kaum messbaren immateriellen Dienstleistung problemlos vernichten und andere dabei begünstigen kann. Und unsere belastende Vergangenheit spielt bei Rezensenten oft eine sehr wichtige Rolle.
Ich habe am 3. Juli 1996 etwas sehr, sehr Wichtiges für mein restliches Dasein gelernt und umgesetzt. Da mir meine Professur nur verliehen wurde, habe ich nie an einer Hochschule für Musik und Theater unterrichtet. Ich habe Vorträge an Universitäten gehalten. Meisterklassen habe ich selten gegeben und dort nur ausländischen Sängerinnen und Sängern Ratschläge erteilt. Deutsche habe ich abgelehnt, mit dem Hinweis, dass sie das deutsche Repertoire singen sollen, siehe der Brief des bayerischen Kultusministers. Wer Wagner singen muss, trägt heute immer einen Rucksack mit sich, darinnen befindet sich ein sehr hinderlicher Amboss mit Namen Hitler. Und Wagners Antisemitismus wächst in jeder Festspielzeit.
Bei Wettbewerben habe ich als Mitglied der Jury ausländische Künstler begünstigt, um nicht ausländerfeindlich zu sein. Mir ist also nicht mehr vorzuwerfen, ich würde mich für meine deutschen Kollegen einsetzen. Der Direktor der Wiener Staatsoper, Ion Holender richtete sich 1998 mit folgender Aussage an das Publikum: „Der Herr Kammersänger Weikl setzt sich für seine Kollegen ein – auch zu seinem Nachteil.“ Meine Karriere war damit auch in Wien zu Ende.
Die Mutter ist schon kurz nach meiner Geburt 1942 mit dem Säugling aus dem nationalsozialistischen Wien geflüchtet. So viel zu einer mir angedichteten „dumpfdeutschen und deutschnationalen“ Einstellung.
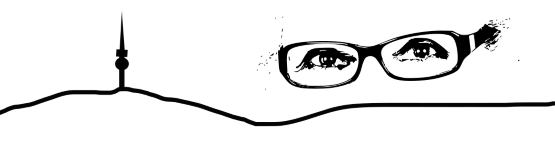





Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.